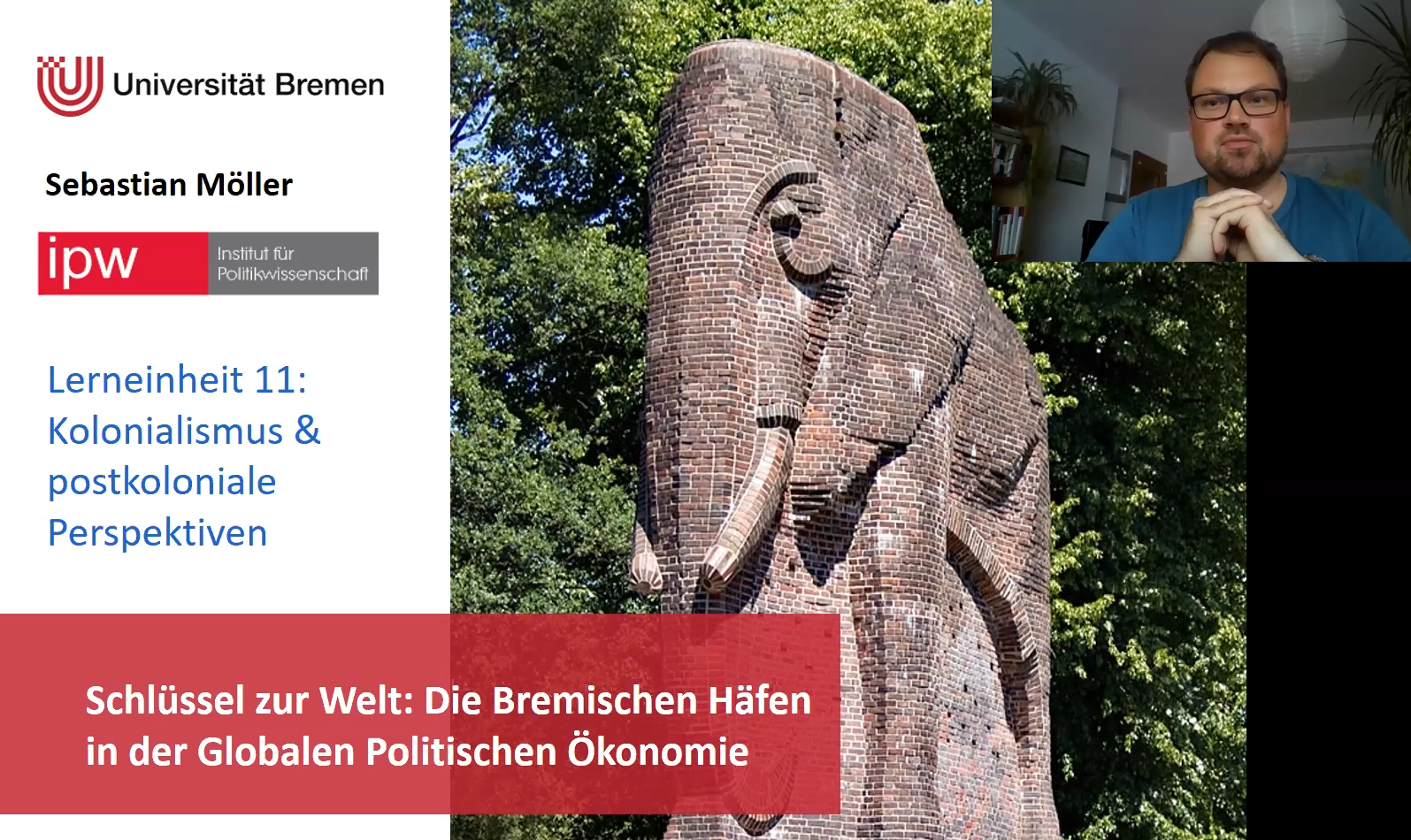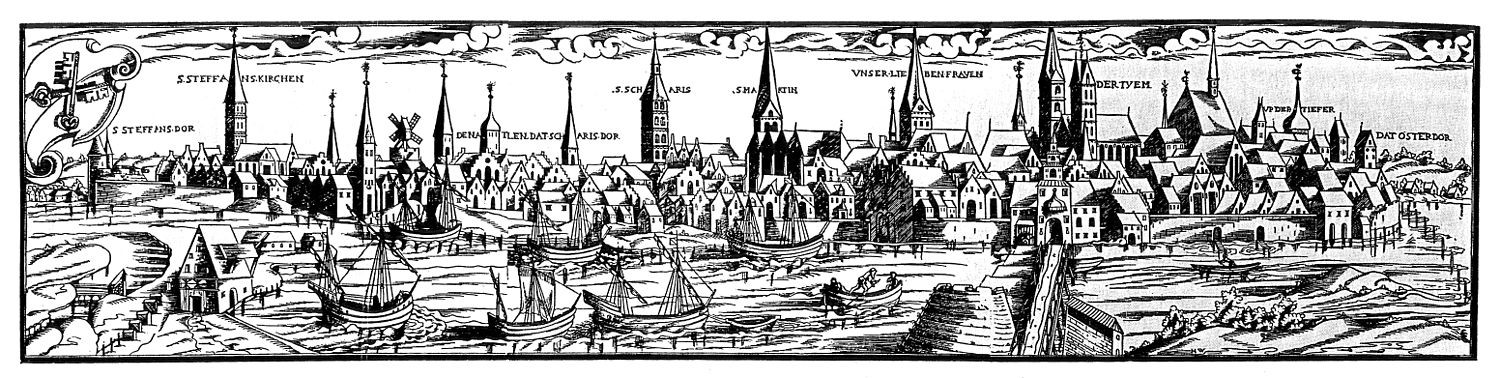Am 28.01.2021 findet an der Uni Bremer der digitale Vortrag “Tanz mit dem Vulkan – die ostdeutschen Werften und der Bremer Vulkan” statt. Der Vortrag des ehemligen Bremer Hafen-Staatsrats Heiner Heseler findet im Rahmen des Verbund-Projektes „Modernisierungsblockaden in Wirtschaft und Wissenschaft der DDR“ (Mod-Block-DDR), dessen Bremer Team von der Ökonomie-Professorin Jutta Günther geleitet wird. Auch im Rahmen unseres Hafenseminars haben wir ausführlich mit der Geschichte des Bremer Vulkans (z. B. im Podcast #7 und dem Beitrag zum Werftensterben) und seinem Engagement bei den Werften in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt.