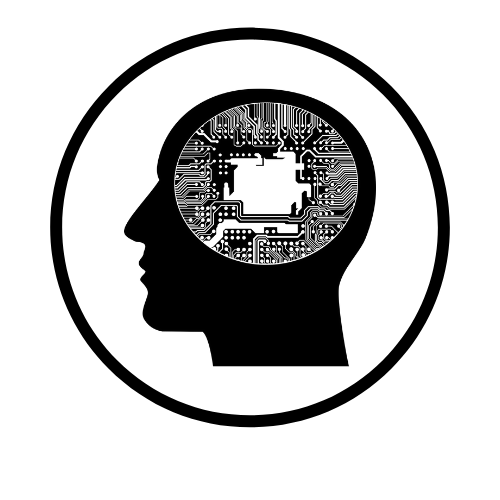Photo by Compare Fibre on UnsplashDer folgende Reflexionsbericht bezieht...

Feindbild Smartphone?
Photo by Tamarcus Brown on Unsplash
Das Thema vom 06. November war: „Feindbild Smartphone?“ Voreinstellungen und Mediennutzung im schulischen Kontext. Der Vortrag soll an dieser Stelle kurz zusammengefasst und anschließend durch meine Erfahrungen im Praxissemester reflektiert sowie entsprechend der Gesamtsituation bewertet werden.
Zunächst wurden die Erfahrungen der Student*innen hinsichtlich des Einsatzes von Medien und Technik im schulischen Umfeld gesammelt und der Begriff Medienkompetenz aufgegriffen und definiert. Laut Prof. Gerhard Lemke (Professor für Digitale Medien) sind es vor allem beim Umgang mit Medien, Prozesse die relevant sind. Kognitive Fähigkeiten müssen durch die Schüler*innen in vorhandenes Kontextwissen eingebunden werden, um sich eindringlich mit den Medien beschäftigen zu können.
Infolgedessen wurde eine JIM (Jugend, Information, Medien) - Studie präsentiert, in der das Medienverhalten von Jugendlichen erhoben wurde. Insgesamt wurden 1200 Jugendliche im Alter von 12-29 Jahren telefonisch befragt. Im Jahr 2018 waren fast alle Haushalte mit einem Smartphone und/oder einem Computer/Laptop ausgestattet. Auch einen Internetzugang und einen Fernseher war für die meisten Befragt*innen verfügbar. 97 Prozent der Jugendlichen besaßen ein Smartphone und nutzten dies hauptsächlich für die Nutzung des Internets, Online Videos und zum Musik hören. Einen Computer/Laptop nutzten wiederum nur etwa zwei Drittel von ihnen. Aufgrund der Ergebnisse der Studie ist es also ein berechtigter Ansatz sich mit der Mediennutzung im schulischen Umfeld auseinanderzusetzen, da alle Jugendliche zumindest mit einem Smartphone auch eine Anbindung zum Internet und der „Digitalen Welt“ besitzen. Im Anschluss wurden über Seafile Apps und Dienste gesammelt, die die Studierenden schon kennen und ihrer Meinung nach geeignet für den Einsatz in der Schule sind. Diese wurden wiederum hinsichtlich des Faches kategorisiert und die Vor- und Nachteile bewertet sowie das mögliche Einsatzgebiet angegeben. Einige dieser Dienste habe ich auch in meinem Praxissemester wiederfinden und den Einsatz im Unterricht beobachten können. Die Lernplattform der Bremer Schulen „itsLearning“ bietet zum Beispiel für alle Schüler*innen den kostenfreien Zugang zu allen Sofatutor-Erklärvideos.
Im Allgemeinen sind insbesondere Dienste interessant, die Kollaboratives Arbeiten ermöglichen oder fachspezifisch einen Lernvorteil mit sich bringen, wie Wörterbuch-Apps im Fach Englisch zum Beispiel.
Im Anschluss wurde das Konzept „MIAU-Digitales Lernen ermöglichen“ vorgestellt. MIAU steht für:
Medientechnischer Rahmen:
Eine medientechnische Grundausstattung muss hinsichtlich technischer Geräte und Verbindungen gegeben sein. Außerdem sollte man sich nicht auf die technischen Lösungen beschränken, sondern weiterhin analoge Möglichkeiten wahren.
Informatik:
Das Unterrichtsangebot muss entsprechend angepasst werden, sodass die Schüler*innen beispielsweise Informatikunterricht oder Medienbezogene Schul-AGs wählen und besuchen können. Um diese Angebote optimal nutzen zu können, müssen bei den Schüler*innen Grundfertigkeiten im Umgang mit Technik und eine generelle Akzeptanz dieser, vorhanden sein.
Austausch und Fortbildung:
Den Lehrkräften müssen Fortbildungen und Schulungen angeboten werden, sodass sie ihren Unterricht an die neuen technischen Möglichkeiten anpassen und dahingehend entwickeln können. Außerdem sollten an den Schulen Unterstützungsstrukturen geschaffen werden. Beispielsweise in Form eines designierten Medienberaters.
Ubiquitäre Fortführung:
Der Einsatz von Medien hängt von den Lehr- und Lernbedürfnissen der Lerngruppe ab. Wichtig ist deswegen, dass sowohl die Technik als auch die Fortbildungsmöglichkeiten stetig an den Bedarf angepasst und diesem entsprechend weiterentwickelt werden.
Festzustellen ist, dass diese Punkte alle mit erheblichen Kosten verbunden sind. Sowohl die Anschaffungs- als auch die Personalkosten würden die jeweiligen Budgets zusätzlich belasten. Häufig werden solche Projekte angestoßen und nicht final geplant und fortgeführt, sodass es in den Schulen zwar Technik gibt, diese aber kaum zum Einsatz kommt oder wenn sie benutzt werden soll dann nicht funktioniert. Diese Erlebnisse sorgen schnell für Frustration bei Lehrenden und Lernenden und dafür, dass sie in Zukunft von einem weiteren medialen Einsatz in dieser Form absehen.
Am Ende der Präsentation wurden noch kurz im Plenum Möglichkeiten diskutiert, um den medienfeindlichen Einstellungen von Kolleg*innen oder Schulen zu begegnen und wie man dem Missbrauch von Smartphones entgegenwirken kann. Im Allgemeinen kann dort
grundsätzlich eine umfangreiche Aufklärung und eine generelle Akzeptanz von verschiedenen Meinungsbildern weiterhelfen. Ferner können durch einen regen Austausch Befürchtungen abgelegt und Sicherheiten mitgegeben werden.
An dieser Stelle möchte ich die Punkte der Präsentation auf mein Praxissemester, das ich an einem Bremer Gymnasium absolviert habe, abbilden und die angesprochenen Themen, insbesondere das „MIAU“-Programm, hinsichtlich meiner dort gesammelten Erfahrungen vertiefend reflektieren.
Grundsätzlich ist nur den Schüler*innen der SEK II die Benutzung des Smartphones auf dem Schulgeländer erlaubt, jedoch waren auch die jüngeren Schüler*innen im Besitz eines solchen und haben es gelegentlich, vermeintlich unbemerkt, benutzt. Im Unterricht wurde das Smartphone allerdings ohne vorherige Nachfrage oder direkte Aufforderung nicht verwendet. Der Unterricht wird an der Schule in Fachunterrichtsstunden und Dalton-Zeit aufgeteilt. Eine 90-minütige Unterrichtsstunde besteht dann aus 60 Minuten Fachunterricht und 30 Minuten Dalton-Zeit. Während der Dalton Zeit können die Schüler*innen eigenständig an ihren Lernplänen arbeiten. Im Folgenden möchte ich den Einsatz von Medien kategorisiert darstellen und anschließend das Gesamte reflektieren:
Einsatz von Medien im Fachunterricht:
In den Unterrichtsstunden wurde fast ausnahmslos der Tageslichtprojektor zum Einsatz von Medien miteingebracht. Die Lehrkräfte haben Folien vorbereitet, konnten diese vor Ort in der Schule drucken und die Informationen für die Schüler*innen an die Wand werfen. Obwohl in vielen Klassenräumen ein Beamer vorhanden ist, sehen die Lehrkräfte meist von der Benutzung ab, da sie dahingehend häufig schon mit technischen Problemen zu kämpfen hatten. Auch ich habe dieses Medium häufig für meine Unterrichtseinstiege genutzt, da ich es für den schnelleren und einfacheren Weg gehalten habe. Meist wurden die Folien nur kurz gezeigt oder dienten dem Vergleich von Aufgaben. Der Aufwand, dafür extra den Beamer an einen Laptop anzuschließen und häufig an- und auszuschalten, wäre meiner Meinung nach für meine Absichten zu groß gewesen. Ferner konnte so parallel auch die Tafel genutzt werden, die bei der Benutzung des Beamers ganz nach unten geschoben werden musste und nicht mehr benutzbar gewesen wäre. Gegebenenfalls wäre deswegen die Platzierung des Beamers in einer anderen Position sinnvoller gewesen. In den Gesprächen mit den Lehrkräften fiel auf, dass sie sich weitestgehend mit den technischen Möglichkeiten allein gelassen fühlen und ferner haben sie das Gefühl, dass wenn sie sich miteinbringen wollen, dies nicht möglich ist.
In der Schule gibt es zwei Räumlichkeiten, die mit interaktiven Whiteboards ausgestattet sind. Auch diese werden sehr selten genutzt und bei meinem ersten Besuch konnte ich direkt Zeuge davon werden, wie die Technik versagt hat und die Schüler*innen anschließend im Chemie- Raum ihren Matheunterricht durchführen mussten. Mir wurde berichtet, dass dies schon häufiger der Fall war und deswegen die Benutzung des Raums vermieden wird.
Einsatz von Medien in der Dalton-Zeit:
In der Dalton-Zeit haben die Schüler*innen häufig viel Zeit an ihrem Smartphone verbracht. Teil ihrer Lehrpläne war es zum Beispiel Videos auf der Erklärvideo-Plattform Sofatutor zu schauen oder Mathematik-Aufgaben über itsLearning, die Online-Plattform der Bremer Schulen, direkt zu bearbeiten. Außerdem diente das Smartphone, der Laptop oder das Tablet für Schüler*innen aller Klassenstufen häufig zur Recherche von verschiedenen Themen. Die Aufforderung zur Recherche war dann Bestandteil des Lehrplans.
Insgesamt denke ich, dass viele Schüler*innen während der Dalton-Zeit das Smartphone sinnvoll genutzt haben. Allerdings glaube ich auch, dass die freie Gestaltung der Nutzung dafür sorgt, dass viele Lernende das „Vertrauen“ missbrauchen. Wenn eine Schüler*in auf dem Smartphone ein Video mit Kopfhörern schaut, ist es nicht gesagt, dass es sich tatsächlich um ein Erklärvideo handelt und wiederum ein leichtes schnell die Apps zu wechseln. Das Verhalten der Lehrkräfte war dahingehend sehr unterschiedlich. Viele haben die Benutzung des Smartphones überprüft, wiederum andere hat es nicht gekümmert. Die Nutzungsmöglichkeit halte ich aber im Allgemeinen für sinnvoll, da die Schüler*innen insbesondere das Recherchieren so steig erlernen. Auch das interaktive Bearbeiten von Aufgaben sorgt für Abwechslung im Schulalltag und macht ihnen häufig mehr Spaß, als Aufgaben auf einem Zettel zu bearbeiten.
Umgang mit dem Home-Schooling in der Corona-bedingten Pause:
Während der Corona-bedingten Pause des Präsenzunterrichts, haben die Schüler*innen ihre Aufgaben via itsLearning zur Verfügung gestellt bekommen. Dabei fiel die Bereitstellung der Aufgaben durch die Lehrkräfte sehr unterschiedlich aus. Manche luden eine PDF-Datei hoch, die die im Buch zu bearbeitenden Aufgaben auflistete, wiederum andere nutzten die Möglichkeiten der Plattform und erstellten interaktive Aufgaben oder kleinere Tests, die die Schüler*innen direkt auf der Seite bearbeiten konnten. Im Gespräch mit den Lehrkräften stellte sich heraus, dass viele sehr unerfahren mit der Lernplattform sind und sich der Möglichkeiten,
die es dort gibt, um beispielsweise Aufgaben zu erstellen und Schüler*innen zu unterrichten, gar nicht bewusst sind.
Im Nachhinein, als der Präsenzunterricht wieder möglich war, hat sich durch die Gespräche mit den Schüler*innen herausgestellt, dass sie häufig mit dem Home-Schooling überfordert waren. Probleme, die immer wieder Erwähnung fanden, waren:
- Sie hatten keine Möglichkeit zuhause die Materialien oder die Aufgaben zu
- Sie hatten keinen Computer/Laptop
- Sie waren es nicht gewohnt mit dem Computer/Laptop oder dem Smartphone zu arbeiten und deswegen häufig überfordert.
- Es fiel ihnen schwer ihren Tagesablauf dahingehend zu strukturieren, dass sie vernünftig arbeiten können.
- Aufgrund ihrer Wohnsituation konnten sie zuhause keine Ruhe zum Arbeiten
Auch Kurse, denen ich interaktive Materialien zur Verfügung gestellt habe, haben häufig ihre Ergebnisse aus zeitlichen Gründen und aus reiner Überforderung nicht abgeben können.
Insgesamt konnten einige Punkte, die das Programm „MIAU“ vorsieht, in dieser Schule wiedergefunden werden. Allerdings haben sich meiner Meinung nach auch viele Probleme in der Schule bemerkbar gemacht. Dadurch, dass der Medientechnische Rahmen zwar vorhanden, aber nicht standardisiert ist, wird er im Allgemeinen sehr wenig genutzt. Hinzukommend fehlt es den Lehrkräften an Unterstützung und an Möglichkeiten sich dahingehend fortzubilden. Die technischen Möglichkeiten werden deswegen außer Acht gelassen, da sie bei Misserfolg oder Verzögerung zu viel Zeit des 60-minütigen Fachunterrichts stehlen. Wenn ein Medientechnischer Rahmen in einer Schule gegeben ist, dann muss meines Erachtens dafür gesorgt werden, dass dieser durch alle Lehrkräfte problemlos genutzt werden kann. Ansonsten wird die weiterführende Technik nach ersten schlechten Erfahrungen, nicht mehr in Betracht gezogen. Hier würde vor allem ein Experte, der sich für die einwandfreie Benutzbarkeit der technischen Möglichkeiten zuständig fühlt, (wie von MIAU vorgesehen) meiner Meinung nach schon direkt weiterhelfen.
Rückblickend sollte den Schüler*innen im Unterricht oder in einer AG der Umgang mit der Lernplattform und den, dort vorhanden Materialien, immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden. So wird verhindert, dass einige von ihnen frustriert sind, weil sie die Aufgaben nicht
bearbeiten können. Gleiches gilt für die Lehrkräfte, die während der Corona-bedingten Pause zum Teil Schwierigkeiten darin hatten, ihre Kurse mit Materialien und Aufgaben zu versorgen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass das „MIAU-Programm“ meiner Meinung nach zukunftsweisend ist und uns auch gerade die Schulzeit während Corona aufgezeigt hat, wie wichtig es ist, sich mit Digitalen Medien und deren Einsatz im schulischen Umfeld zu beschäftigen. Der Erfolg eines solchen Programmes hängt jedoch vom Etat und von der Bereitschaft der Lehrkräfte, sich und seinen Unterricht weiterentwickeln zu wollen, ab. Aufgrund dessen sollten im Vorfeld entsprechende Strukturen geschaffen werden, sodass es beispielsweise einheitliche Ausstattungen und Experten vor Ort gibt. Ferner sollten dann, sobald diese Strukturen geschaffen wurden, sowohl Lernende als auch Lehrende in die Pflicht genommen werden, diese zu nutzen. Dabei sollte auch insbesondere darauf geachtet werden, dass im Kollegium keine negative Stimmung aufkommt und die Möglichkeiten kollektiv mitgetragen werden.
Mir persönlich ist während dieser Zeit aufgefallen, dass ich mich in meiner Lehrerausbildung fortlaufend mit den Lernplattformen und hilfreichen Online Diensten beschäftigen möchte. Meiner Meinung nach bieten diese sehr einfache und hilfreiche Möglichkeiten, den Unterricht abwechslungsreich für mich selbst und für die jeweilige Lerngruppe zu gestalten.
Dieses Werk ist unter der CC-0-Lizenz veröffentlicht.
![]()