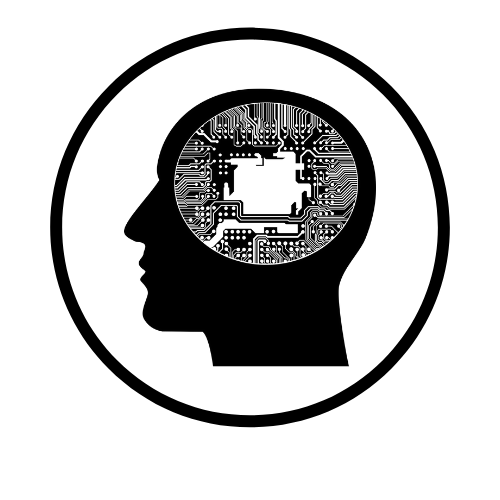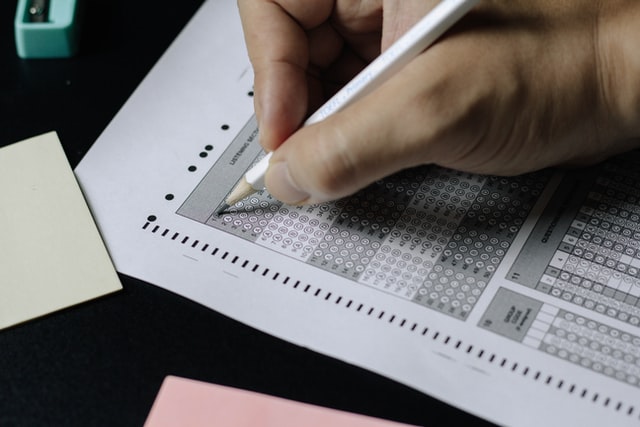
Summatives vs. formatives Assessment im digitalen Raum
In meinem Reflexionsessay für das Seminar „Mediendidaktik & Medienbildung. Digitale Elemente in der Lehre und in der Gesellschaft“ möchte ich mich auf das Thema „digitale Prüfungen“ beziehen und erörtern, ob ich digitale Prüfungen auch im Bereich der Sekundarbildung, also an den Oberschulen und Gymnasien für sinnvoll halte und was für mich eine gute Onlineprüfung ausmacht. Grundlage hierfür sind meine eigenen Erfahrungen und Vorwissen, sowie der Inhalt der dazugehörigen Einheit im Seminar. Zur Klassifizierung der Prüfungsarten verwende ich die Klassifizierungen von Schmees, Krüger und Schaper (Schmees 2013, 21).
Besonders in den zwei vergangenen „Pandemiejahren“ haben digitale Prüfungen, zumindest im Hochschulbereich, offenkundig stark an Bedeutung gewonnen. Ich selbst habe natürlich auch Erfahrungen mit digitalen Prüfungsleistungen gemacht. Bei diesen Prüfungen handelte es sich immer um summative Assessments, also Prüfungen, auf die eine Bewertung folgt. Hier habe ich in der Qualität der Prüfungen deutliche Unterschiede feststellen können. Eigentlich scheint es selbstverständlich, dass reine Wissensabfragen in Form von Single- oder Multiple Choice Fragebögen nicht tauglich sind, um summative Onlineprüfungen durchzuführen. Bei solchen Onlineprüfungen kann offenkundig sehr einfach betrogen werden, da die Antworten auf die Fragen einfach im Internet oder in einem Buch nebenbei recherchiert werden können. Dennoch führen einige Universitäten in Deutschland genau solche Onlineprüfungen durch. Um die Student:innen zu kontrollieren und Täuschungsversuche zu unterbinden, werden diese dazu verpflichtet, ihre Webcams einzuschalten und sich bei der Durchführung der Klausur überwachen zu lassen. Hier ist die Rechtslage fragwürdig (FAZ 2021). Außerdem zeigen Dozent:innen, die auf diese Art und Weise Onlineprüfungen durchführen, meiner Meinung nach nur, dass sie nicht motiviert sind sinnvolle online Assessments durchzuführen, oder nicht die Kompetenzen besitzen, gute Onlineprüfungen zu erstellen. Solche Prüfungen, die nur die Reproduktion von Wissen fordern, sind meiner Meinung nach in keiner Weise als Onlineprüfungen tauglich. Ob diese Art von Prüfung als summative Assessments überhaupt sinnvoll sind ist ebenfalls diskutabel. Dieses offensichtliche Problem der Kontrollierbarkeit gilt natürlich auch bei Prüfungen in der Schule. Ich sehe ausschließlich Nachteile summative single-choice oder multiple-choice Prüfungen online durchzuführen.
Ich finde, dass summative Onlineprüfungen über den Bereich der Reproduktion hinausgehen müssen. Das geht einher mit alternativen Prüfungsformen, die nicht nur aus reinen Wissensabfragen bestehen, sondern Transferwissen und problemlösendes Denken fordern. Hier möchte ich ein positives Beispiel aus meinem Geographiestudium nennen. Im Seminar zur Einführung in die Paläoklimatologie musste die Klausur am Semesterende pandemiebedingt online stattfinden. Hier hat der Dozent eine Onlineklausur entworfen, in der alle Inhalte (Folien etc.) des Seminars als Hilfsmittel genutzt werden durften. Da es aber in der Klausur so gut wie keine reine Reproduktionsaufgabe gab, waren diese nur nützlich als Nachschlagewerke für einzelne Daten wie zum Beispiel Beginn und Ende einer bestimmten Eiszeit. Diese hätte man in einer konventionellen Reproduktionsklausur auswendig lernen müssen und danach sowieso wieder nach kurzer Zeit vergessen. In der Onlineprüfung jedoch, musste dieses Faktenwissen angewandt werden. Dies bedurfte ein Verständnis der in der Paläoklimatologie wichtigen Prozesse. Bestehen konnte die Klausur also nur jemand, der diese Prozesse verstanden hat und diese Wissen in der Klausur anwenden kann und die in der Klausur dargestellten Probleme mithilfe dieses Verständnisses lösen kann. Meiner Meinung nach bieten solche Prüfungen, online wie offline, viel mehr Vorteile als die bereits genannten Reproduktionsprüfungen. Zum einen müssen die geprüften nicht Unmengen an Daten und Fakten auswendig lernen. Zum anderen zeigen sie, dass sie die Kompetenz besitzen diese Daten und Fakten selbst nachzuschlagen und, noch wichtiger, diese dann im richtigen Kontext anzuwenden. Hier hat die Pandemie und der damit verbundene Zwang zu Onlineprüfungen ein Umdenken bei der Prüfungserstellung bewirkt, an welchem hoffentlich festgehalten wird.
Doch sind solche Onlineprüfungen auch für den Einsatz in Oberschulen und Gymnasien geeignet? Meiner Meinung nach bedarf es bei solchen Onlineprüfungen, bei denen der Wissenstransfer und die Problemlösung im Vordergrund stehen, ein Thema, welches komplex genug ist, dass selbst wenn die Prüflinge auf das Internet zurückgreifen, um die Fragen in der Prüfung zu beantworten, sie diese nur lösen können, wenn sie die zugrundeliegenden Prozesse verstehen und die Recherche im Internet zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, um die Fragen vor der Abgabezeit zu beantworten. Diese Voraussetzung sehe ich in der Schule in den meisten Fällen nicht gegeben. Hier sind die Themen meist nicht komplex oder speziell genug, um eine Internetrecherche zu zeitaufwendig zu machen. Bestimmt gibt es hier auch Ausnahmen. Gerade in Leistungskursen der Q2 könnten solche Onlineprüfungen eventuell durchgeführt werden. Wenn dies möglich ist, denke ich, dass diese Prüfungen einen großen Mehrwert besitzen. Zum einen wird die Transferkompetenz der Schüler:innen gefördert, zum anderen erhält die Lehrkraft ein eindeutiges Feedback darüber, ob die Schüler:innen die wichtigen Prozesse kennen und nicht, ob diese Fakten und Daten gut auswendig lernen können.
Bei allen Überlegungen über Onlineprüfungen in den Schulen muss selbstverständlich immer die Frage nach deren Mehrwert gestellt werden. Denn selbst in den Pandemiejahren fanden die Prüfungen an den Schulen so gut wie immer in Präsenz statt. Haben Onlineprüfungen überhaupt einen Platz in der Schule, oder sind Präsenzprüfungen immer vorzuziehen? Meiner Meinung nach kann und wird auch in guten Präsenzklausuren Transferwissen gefordert und Reproduktionsprüfungen sind nur in Präsenz wirklich sinnvoll. Ich denke, dass das Prinzip Onlineprüfungen in den Schulen fernab von summativen, also Prüfungen des Lernergebnisses, einen Platz finden können. Hier halte ich vor allem formative Portfolioprüfungen für sinnvoll. Bei diesen Assessments können die Schüler:innen Zwischenschritte hin zum Lernziel dokumentieren und ihr eigenes Portfolio letztendlich der Klasse vorstellen. Dies kann natürlich auch wieder eine benotete Prüfung sein. Bei der Erstellung eines E-Portfolios kann selbstverständlich auch auf den Schüler:innen wahrscheinlich bekannte Medien zurückgegriffen werden. Sie können z.B. eine eigene Instagram-Seite managen und moderieren und auf dieser ihre Portfolios verwalten. So könnte ein Realitätsbezug zu den Leben der Schüler:innen hergestellt werden, der für Motivation sorgen kann.
Die vorangehenden Überlegungen bringen mich zu dem Schluss, dass summative Onlineprüfungen, meiner Meinung nach, keine Zukunft an den Schulen haben werden und weiterhin hauptsächlich an den Universitäten und Hochschulen zum Einsatz kommen werden. Formative Assessmentformen wie z.B. ein E-Portfolio können im Unterricht für Abwechslung sorgen und eine Grundlage für summative Leistungsbewertung bilden.
Literatur
Schmees, Markus, Marc Krüger, and Elisabeth Schaper. E-Assessments an Hochschulen: Ein vielschichtiges Thema. 2013.
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. CC-BY: Joseph Pape