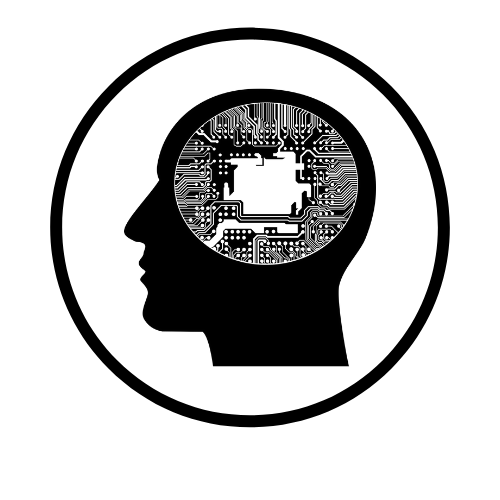Die Sache mit der Online-Lehre…
Photo by Victoria Heath on Unsplash
Während die Politik nicht müde wird, uns Studierende zu bedauern, weil wir unsere Zeit aktuell leider nicht so verbringen können, wie sich die breite Masse das Student:innenleben eben vorstellt, und die Medien von Corona-Müdigkeit und Lockdown-Langeweile berichten, habe ich ganz andere Sorgen. Langweilig war mir in den vergangenen Monaten mit Sicherheit nicht, ganz im Gegenteil: Das gesamte Semester über war ich dermaßen beschäftigt damit, irgendwelche Texte vor oder zwischen den Konferenzen, die auf verschiedensten Plattformen mal mehr, mal weniger erfolgreich stattfanden, zu lesen, „Hausaufgaben“ zu machen, abweichende Termine aus kryptischen E-Mails (gerne auch ohne Betreff, Anrede und/oder Grußformel), unterschiedlichen hochgeladenen Seminarplänen, Ankündigungen auf der Stud.IPVeranstaltungsseite und wieder anderen Ankündigungen unter dem Reiter „Meetings“ zu einem wöchentlich wechselnden Stundenplan zusammenzufügen und einfach (das war ein Witz) irgendwie mit dem Stoff mitzukommen, dass ich bis Mitte Januar gebraucht habe, mir einen Überblick über sämtliche Prüfungs- und Studienleistungen zu verschaffen. Dann kam der Schock-Moment: Für viele der Prüfungen war die Deadline wegen der ab März anstehenden Praxisphase vorgezogen. Dazu kam, dass das Semester coronabedingt später angefangen hatte und demnach auch später enden würde. Ich hatte also knapp eineinhalb Monate um zwölf verschiedene Hausarbeiten, Klausuren, Portfolios oder mündliche Prüfungen zu schreiben beziehungsweise abzulegen. Das bedeutete durchschnittlich zwei Leistungen pro Woche – zusätzlich zu all den Konferenzen und Co.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Auch ich bin nicht perfekt. Da ich allerdings bisher ohne größere Katastrophen durch mein Studium gekommen bin, möchte ich nicht so recht glauben, dass einzig und allein meine mangelnde Organisation an der Situation schuld wäre – zumal ich nicht den Eindruck habe, mit meinen Sorgen allein zu sein. Egal welche Kommiliton:innen oder Freund:innen ich frage: Keine:r sagte mir, das Semester liefe gut. Stattdessen wird sich über mangelnde Kommunikation, einen viel zu hohen Workload und undurchsichtige Angaben beschwert.
Aber was läuft denn eigentlich schief? Wir leben doch schließlich in einer digitalisierten Welt! Selbst mit meinen Eltern kommuniziere ich mittlerweile hauptsächlich über WhatsApp und Face-Time, wenn ich nachts aufwache und unbedingt wissen muss, ob Pinguine Knie haben, gebe ich die Frage bei Google ein, Häkeln und Seifesieden habe ich durch das Ansehen von Youtube-Tutorials gelernt und wenn ich mitten im Shutdown ganz dringend eine Heißklebepistole brauche, bestelle ich sie bei Amazon. Mein halbes Leben spielt sich online ab. Wieso scheint es da unmöglich, auch die Uni für ein paar Monate ins Netz zu verlegen?
Meine Theorie ist recht simpel: Weil nicht alle Beteiligten zu begreifen scheinen, dass auch online die gleichen Regeln gelten müssen, wie in der realen Welt. Das betrifft nicht nur die Lehre und vielleicht wird durch die folgenden, zugegebenermaßen etwas plakativen, Beispiele aus anderen Bereichen etwas einfacher ersichtlich, was ich meine. Seien es Trolle, die sich in sozialen Netzwerken… nun ja… nicht unbedingt den gesellschaftlichen Vorgaben betreffend respektvoller Kommunikation entsprechend verhalten, Menschen, die ihre Rechnungen vom Online-Händler ewig liegen lassen oder solche, die auf eine Frage per SMS einfach nicht antworten – ich wage zu bezweifeln, dass sich sonderlich viele von diesen Personen im wahren Leben trauen würden, auf einem öffentlichen Platz Leute niederzumachen, ohne zu bezahlen aus dem Supermarkt zu marschieren und der Kassiererin zuzurufen „Ich bezahle dann in einem halben Jahr“ oder inmitten eines Gespräches vis-à-vis ohne vorige Ankündigung aus dem Raum zu spazieren. So funktioniert gesellschaftliches Zusammenleben einfach nicht. Warum sollte das online anders sein?
Was bedeutet diese Theorie also für die „Home-Uni“? Betrachten wir dafür zunächst nur die Lehre an sich. Probleme in diesem Semester waren unter anderem, dass oft nicht klar war, was eigentlich das Lernziel der Sitzung oder auch des ganzen Kurses war, dass in manchen Seminaren nur die Hälfte der Termine überhaupt stattfanden, dass die einzelnen Sitzungen teils wenig strukturiert erschienen und dass sich, ob absichtlich oder nicht, nicht immer an grundlegende Kommunikationsregeln, wie zum Beispiel „nicht ins Wort fallen“ gehalten wurde – weder seitens der Studierenden noch der Dozent:innen. Dazu kam, dass es in einigen Kursen keine begleitenden Präsentationen gab, die Dozierenden zum Teil nicht einmal selbst die Kamera angestellt hatten, teilweise noch drei Tage vor der Prüfung die Modalitäten neu definiert wurden und dass der zusätzliche Workload, der durch einige Arbeitsformen in der Fernlehre entsteht (beispielsweise wenn Seminarsitzungen durch seitenweise Text, der in der Stunde sonst zusammengefasst vorgetragen worden wäre, zum selbst erarbeiten ersetzt werden) oft nicht einberechnet wurde. All diese Sachen, von mangelnder Struktur bis hin zum Fehlen von Respekt in der Kommunikation und von Anerkennung in Form von Credits für geleistete Arbeit sind nicht deshalb schlimm, weil sie online stattfanden. Sie hätten auch in der Präsenzlehre zu Unmut geführt. Ich möchte nicht verschweigen, dass auch viele Studierende sich nicht angemessen verhalten haben. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn die Lehrenden keine Lust haben, den ganzen Tag gegen eine Wand aus kleinen schwarzen Rechtecken zu sprechen, hinter denen sich nicht selten Student:innen verbergen, die nur mit halbem Ohr zuhören, weil sie nebenbei Geschirr spülen oder Candy Crush spielen. Dies geschah allerdings, meinen Beobachtungen nach, viel weniger in „guten“ Veranstaltungen als in den Negativbeispielen. Die große Frage lautet also „Was ist gut?“. Um sie zu beantworten, möchte ich im Folgenden eine Liste mit Aspekten aufstellen, von denen „die Forschung und ich“ uns wünschen würden, dass sie von allen Lehrenden berücksichtigt würden:
- Lehre will geplant sein. Das bedeutet nicht nur, dass von vornherein deutlich kommuniziert werden sollte, wie sich die Rahmenmodalitäten gestalten (Taktung, Dauer, Prüfungsform, et cetera), sondern, dass auch die Lernziele und die Didaktik als Weg, über den die angestrebten Kompetenzen erreicht werden sollen, klar sein müssen (Ulrich, 2016, S. 37-49).
- Lehrende brauchen gewisse Präsentationskompetenzen. Dazu gehört neben Kenntnissen aus den Bereichen Rhetorik, inhaltlicher Strukturierung und Mediennutzung auch das große (und wichtige!) Feld der Kommunikation (ebd., S. 75-84).
- Ein dritter sehr wichtiger Aspekt ist der der zwischenmenschlichen Interaktion: Freundlichkeit und Respekt sowie Fairness und Erreichbarkeit sind nur einige der Schlagwörter, die das Lernklima und so auch das Lernen an sich maßgeblich beeinflussen können (ebd., S. 89-98). Auch die persönliche Beratung (zum Beispiel im Rahmen von Sprechstunden) von Studierenden fällt in diese Kategorie und stellt eine Kernaufgabe der Lehre dar (ebd., S. 149-152).
- Gewisse Kenntnisse aus den Bereichen der Lerntheorie (Wie fördere ich Lernen? Wie didaktisiere ich Material? Wie motiviere ich Studierende? Wie kann ich auf die Bedürfnisse einer konkreten Lerngruppe besser eingehen?) wären ebenfalls für jede:n Lehrende:n, egal ob in der Schule, dem Studium oder der Erwachsenenbildung, wünschenswert, da sie nachhaltiges Lernen stark erleichtern können (ebd., S. 103-136).
- Last but not least: Weil kein Mensch perfekt ist und sich die Anforderungen an Lehre im Laufe der Zeit ständig ändern, sind auch Evaluation, Reflexion und letztlich Innovation nicht aus dem Kontext des Lehrens und Lernens wegzudenken (ebd., S. 157-194).
Reicht es denn dann, wenn ich einfach diese fünf grundsätzlichen Gebote der Hochschullehre einhalte, egal ob ich mich online oder offline bewege? Ich fürchte nicht. Beiden „Welten“ liegen verschiedene Umstände zu Grunde, an die sich zusätzlich angepasst werden muss. Bezüglich des Beispiels „Einkaufen“ müssen Käufer und Käuferinnen akzeptieren, dass es im Netz zwar häufig ein größeres Angebot gibt, es aber sehr viel schwieriger ist, fachkundige Beratung zu erhalten. Stattdessen müssen gegebenenfalls Testberichte und Rezensionen gelesen und Informationen eigenständig recherchiert werden. Ebenso bietet auch die Online-Lehre Vor- und Nachteile, die gegebenenfalls berücksichtigt beziehungsweise ausgeglichen werden wollen. So zum Beispiel erfordert E-Learning von den Studierenden große Anstrengungen im Bereich der Selbstregulation und auch eine erhöhte „Gefahr einer kognitiven Überlastung der Lernenden aufgrund komplexer Instruktionsdesigns“ besteht (ebd., S. 140). Vor diesem Hintergrund erscheint es umso wichtiger, dass Online-Lehre nicht so umfangreich, sondern so didaktisch passend wie möglich konzipiert wird. Zudem sollte auf technische Aspekte, Lernpersönlichkeiten, Nachvollziehbarkeit und Ähnliches geachtet werden (ebd., S. 141-143).
Eine besondere Rolle kommt außerdem der Kommunikation zu. Dass sie die Basis einer jeden erfolgreichen Zusammenarbeit, ob online oder offline, ist, lässt sich unter anderem daran erkennen, dass sie für vier der fünf aufgeführten Hauptaspekte (lediglich Punkt vier könnte sich, wenn auch nur eingeschränkt, ohne umsetzen lassen) überaus bedeutsam ist. Doch nicht nur das: Gerade in einer so ungewöhnlichen Situation wie jetzt, wo wir alle einer gewissen Pandemie wegen soziale Isolation betreiben, sollten wir, meines Erachtens nach, darauf achten, zumindest noch unsere Kommunikation aufrecht zu erhalten. Wie sonst sollten wir noch Brücken schlagen? Wie, wenn nicht durch offene Kommunikation, sollten Lehrende erfahren, wie es gerade den Lernenden geht und anders herum? Und außerdem: Was ist ein Mensch ohne andere Menschen? Ich denke, dass wir gerade jetzt, während wir uns körperlich voneinander entfernen, zumindest im Gespräch mehr denn je aufeinander zugehen sollten – um unserer eigenen Menschlichkeit willen!
Ein Gedanke, der mir während des Schreibens kam, ist, dass interessanterweise viele der aufgelisteten Punkte in meinen Augen nicht nur für die Hochschullehre, sondern auch für das „ganz normale Leben“ von Bedeutung sind: Strukturen vorgeben und sich daran halten, auf die (Körper-)Sprache achten, Höflichkeit zeigen, empathisch handeln, die eigene Sichtweise darstellen und die persönlichen Denk- und Handlungsmuster hinterfragen – all das sind Sachen, die auch zum Alltag irgendwie dazugehören. Sich mit ihnen zu beschäftigen, könnte aus uns also nicht nur bessere Lehrende und Lernende machen, sondern auch bessere Menschen.
Genug des Philosophierens. Zum Schluss möchte ich nur noch einen kleinen Hinweis aussprechen: Während der Recherche für diesen Artikel, bin ich auf ein Buch gestoßen, welches mir schlicht und ergreifend aus der Seele sprach. Die Rede ist von Immanuel Ulrichs „Gute Lehre in der Hochschule. Praxistipps zur Planung und Gestaltung von Lehrveranstaltungen.“, erschienen 2016 im Springer-Verlag. Es war keine Faulheit, derer wegen ich in diesem gesamten Text keine andere Quelle zitiert habe. In diesem Buch stand einfach kurz und simpel erklärt alles drin, was ich im letzten Semester vermisst habe, daher habe ich keine Notwendigkeit gesehen, mich noch anderweitig umzuschauen. Vor diesem Hintergrund möchte ich dessen Lektüre allen Lehrenden und solchen, die es werden wollen, wärmstens ans Herz legen. Studentische Dankbarkeit wäre Ihnen gewiss! 😉
Bibliographie
Ulrich, Immanuel (2016): Gute Lehre in der Hochschule. Praxistipps zur Planung und Gestaltung von Lehrveranstaltungen. Wiesbaden: Springer Fachmedien.