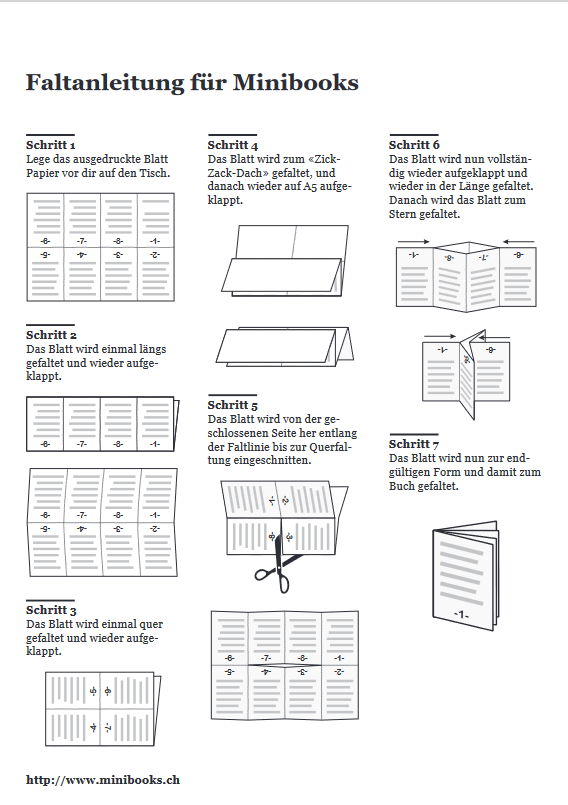Das Gruppenpuzzle
Beschreibung der Methode
Das Gruppenpuzzle. Eine Methode, die für eine hohe Aktivität der Schüler*innen bekannt ist und zugleich auch ihre Wertschätzung untereinander stärkt.
Dadurch, dass die Schüler*innen eine große Verantwortung für die Erarbeitung und Vermittlung ihres Teilthemas übernehmen und dies nur innerhalb von kleinen Schüler*innengruppen durchführen, ist die Methode sehr gut dazu geeignet das selbstständige Lernen der Schüler*innen zu fördern, ihr Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit zu stärken und den Gruppenzusammenhalt in der Lerngruppe zu stärken. Darüber hinaus trägt die gegenseitige Vermittlung der Thematiken der Schüler*innen untereinander auch dazu bei ihren Verständnisprozess zu fördern, da Schüler*innen weniger dazu neigen abstrakte und technische Ausdrücke zu verwenden und somit in einer „einfacheren“ Sprache kommunizieren.
Ablauf der Methode (vgl. Lehrerinnenfortbildung Baden-Wüttemberg o.J., o.S.)
Die Methode des Gruppenpuzzles lässt sich dabei in drei Phasen unterteilen.
Phase 1
Die Lehrkraft teilt die Lerngruppe z.B. durch das Zufallsprinzip in „Stammgruppen“ ein, die jeweils aus 3-6 Schüler*innen bestehen können. Jedes Mitglied der Stammgruppe erhält einen anderen Ausschnitt der Thematik, welchen es mithilfe von Selbststudienmaterial z.B. durch ein Erklärvideo oder einen Informationstext und ein zugehöriges Arbeitsblatt selbstständig zu erarbeiten gilt. Die Arbeitszeit der individuellen Bearbeitung kann dabei zum Beispiel 10 Minuten betragen.
Phase 2
Anschließend setzen sich alle Schüler*innen, die das gleiche Teilthema erarbeitet haben in sogenannten „Expert*innengruppen“ zusammen. Innerhalb dieser Gruppen tauschen sich die Schüler*innen über ihre Thematik, sowie über die dazu bearbeiteten Aufgaben aus. Im nächsten Schritt bereiten die Schüler*innen innerhalb der Expertengruppen die Vermittlung ihres Teilthemas an die anderen Schüler*innen vor indem sie klären, welche Informationen zu dem Verständnis der Thematik am grundlegendsten sind und wie diese vermittelt werden können. Die Arbeitszeit innerhalb der „Expert*innengruppen“ kann dabei zum Beispiel 15-20 Minuten betragen.
Phase 3
Im letzten Schritt setzen sich die Schüler*innen wieder in die „Stammgruppen“ aus der Phase 1 zusammen. Innerhalb dieser Gruppen vermitteln die Schüler*innen nacheinander ihr erlerntes Wissen über ihr Teilthema an die Mitschüler*innen. Die Mitschüler*innen hören dabei zu, notieren die wichtigsten Inhalte auf dem Arbeitsblatt und haben die Möglichkeit, Fragen an die „Expert*innen“ zu stellen. Ebenso besteht auch die Möglichkeit, über einzelne Beiträge zu diskutieren. Für diese Phase können die Schüler*innen beispielsweise eine Zeitdauer von 10 – 15 Minuten erhalten.
Benötigte Medien und Materialien
Die benötigten Medien und Materialien hängen davon ab, wie die Methode angewendet wird.
Zunächst ist es dabei im Rahmen der ersten Phase als Lehrkraft notwendig Selbststudienmaterial für die Schüler*innen bereitzustellen. Dabei können entweder Informationstexte für alle Teilthemen erstellt werden oder es können zum Beispiel auch durch Links (Erklär-)Videos für alle Teilthemen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sollten alle Schüler*innen ein Arbeitsblatt erhalten, auf dem die Aufgabenstellungen zu allen Thematiken zu finden sind. Dieses soll dabei in der Sicherungsphase von den Schüler*innen bearbeitet werden.
Zur Aufteilung der Lerngruppe in die Stammgruppen können zudem kleine Zettel angefertigt werden, auf denen jeweils ein Buchstabe und eine Zahl vorhanden ist. Die Zahl, die die Schüler*innen erhalten steht dabei für die Stammgruppe, während der Buchstabe für die Expert*innengruppe steht. Dadurch wäre eine Zuordnung der Schüler*innen durch das Zufallsprinzip möglich. Ebenso könnten dann die Tische mit den jeweiligen Zahlen und Buchstaben z.B. durch kleine Schilder beschriftet werden, sodass die Schüler*innen in jeder Phase wissen, wo sie sich zuordnen müssen.
Variation der Methode
Das Gruppenpuzzle bietet eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten. Zum einen kann das Gruppenpuzzle in fast allen Fächern, sowie auch bei einer Vielzahl von Themen, die sich in Teilthemen untergliedern lassen, angewendet werden. Neben dem Chemieunterricht und der Thematik des Atombaus lässt sich die Methode beispielsweise auch gut im Biologie-Unterricht in den Thematiken „Aufbau der Zelle“ oder „Die Verdauung“ verwenden. Zudem kann die Methodik des Gruppenpuzzles zum Beispiel auch im Rahmen des Politik- oder Geschichtsunterrichts eine Anwendung finden. Dabei besteht die Möglichkeit durch das Gruppenpuzzle verschiedene Standpunkte zu einer Thematik zu vertreten.
Darüber hinaus bietet das Gruppenpuzzle jedoch auch verschiedene Variationsmöglichkeiten in seiner Anwendung an sich. Zum einen gibt es dabei verschiedene Möglichkeiten welches Selbststudienmaterial den Schüler*innen zur Verfügung gestellt werden kann. Dies können nicht nur (Erklär-)Videos und Informationstexte, sondern zum Beispiel auch verschiedene Experimente sein. Zum anderen besteht jedoch auch eine große Variationsmöglichkeit innerhalb der Ergebnissicherung der Schüler*innen in den Gruppen. Neben der Möglichkeit die Aufgabenstellungen zu den Teilthemen auf einem Arbeitsblatt beantworten zu lassen, bestehen jedoch auch die Möglichkeiten Plakate oder Collagen anfertigen zu lassen auf denen die Ergebnisse dargestellt werden. Darüber hinaus gibt es dann auch die Möglichkeit kurze Präsentationen zu den einzelnen Teilthemen von den Schüler*innen halten zu lassen. Eine weitere Variationsmöglichkeit bietet die Methode jedoch auch hinsichtlich der Anzahl an Expert*innen in den Stammgruppen. Demnach besteht auch die Möglichkeit, dass es zwei Expert*innen pro Stammgruppe gibt. Dies könnte dann der Fall sein, wenn sich ein Thema nur in eine geringe Anzahl an Teilthemen unterteilen lässt und/oder eine große Anzahl an Schüler*innen in der Lerngruppe vorhanden ist. Durch das Erhöhen der Anzahl an Expert*innen pro Gruppe und das gegenseitige Unterstützen dieser untereinander erfolgt in diesem Rahmen auch gleichzeitig eine Differenzierung.
Praxisbeispiel und Rückmeldung zur Methode
Ein Praxisbeispiel stellt das Gruppenpuzzle im Rahmen der Thematik „Aufbau des Periodensystems“ im Chemieunterricht dar. Dabei wird die Lerngruppe durch das Zufallsprinzip mit Hilfe von gezogenen Zetteln, auf denen jeweils ein Buchstabe und eine Zahl vorhanden ist, in vier „Stammgruppen“ unterteilt. Jede*r Schüler*in der „Stammgruppe“ setzt sich dabei im Rahmen der ersten Phase zuerst individuell mit einem unterschiedlichen Teilthema der folgenden vier Teilthemen mithilfe von verlinkten Videos und einem Arbeitsblatt auseinander: 1. Die Geschichte des Periodensystems, 2. Der Aufbau des Periodensystems, 3. Der Atomradius, 4. Die Elektronegativität. Im Rahmen der zweiten Phase setzen sich die Schüler*innen dann mit dem gleichen Teilthema in Expertengruppen zusammen und besprechen die Aufgaben, die auf dem Arbeitsblatt, welches sie erhalten haben, vermerkt sind. Darüber hinaus klären die Schüler*innen im Rahmen dieser Phase auch welche Informationen sie zu ihrem Teilthema an die anderen Mitschüler*innen vermitteln wollen. In der letzten Phase setzen sich die Schüler*innen wieder in den „Stammgruppen“ aus der ersten Phase zusammen und erklären sich gegenseitig ihre erlernten Inhalte und sichern diese zusammen auf dem Arbeitsblatt, sodass jede*r Schüler*in am Ende alle Aufgaben zu allen Teilthemen bearbeiten konnte.
Während der Anwendung dieser Methode haben wir feststellen können, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, ihre Effektivität im Lernprozess der Schüler*innen zu steigern. Zum einen gibt es die Möglichkeit, die zweite Phase der Gruppenarbeit in den Expert*innengruppen zu strecken, damit ein längerer Austausch über die in der ersten Phase selbstständig erarbeiteten Inhalte stattfinden kann und diese dadurch noch besser verstanden und gefestigt werden können. Dafür könnten die erste und die dritte Phase des Gruppenpuzzles in den „Stammgruppen“ gekürzt werden und einen geringeren Zeitumfang als die zweite Phase erhalten.
Um weiterhin die Effektivität der Methode im Lernprozess der Schüler*innen zu steigern, besteht jedoch auch die Möglichkeit innerhalb der Methode zu differenzieren, wobei die unterschiedlich anspruchsvollen Teilthemen den Schüler*innen, je nach ihrem Leistungsstand zugeordnet werden könnten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es innerhalb der „Stammgruppen“ trotzdem zu einer Heterogenität innerhalb der Leistungsstände der Schüler*innen kommt, damit sich auch alle Schüler*innen im Austausch untereinander beteiligen und sich gegenseitig unterstützen können. Eine weitere Möglichkeit zu differenzieren wäre es dabei auch den Schüler*innen unterschiedliche Selbststudienmaterialen wie zum Beispiel Informationstexte und (Erklär-)Videos zur Verfügung zu stellen und sie selbst wählen zu lassen mit welchem der Materialien sie arbeiten möchten.
Zuordnung zur AVIVA-Phase (vgl. Transfer 2021, o.S.)
Die Methodik „Gruppenpuzzle“ kann dabei drei Phasen des AVIVA-Modells zugeordnet werden. Bei diesen drei Phasen handelt es sich um „Informieren“, „Verarbeiten“ und „Auswerten“.
In der Phase „Informieren“ fördert die Methodik das Verständnis einer Thematik, indem die Schüler*innen sich ihre Ressourcen bezüglich eines Teilthemas mithilfe des Arbeitsmaterials aktiv selbstständig aneignen.
In der Phase „Verarbeiten“ wenden die Schüler*innen das erlernte Wissen aktiv an, indem sie die anderen Mitschüler*innen über ihr Teilthema informieren und darüber diskutieren. Dabei trägt auch der Erklärprozess der Schüler*innen untereinander zum vertieften Verständnis, sowie zur Sicherung und Festigung der entwickelten Ressourcen bei.
In der Phase „Auswerten“ kann das Gruppenpuzzle auch dazu dienen das Verständnis weiter zu festigen, indem die Ergebnisse des Gruppenpuzzles zum Beispiel innerhalb der gesamten Lerngruppe präsentiert werden können. Dabei werden die Inhalte der Thematik noch einmal aufgegriffen, diskutiert und gefestigt. So kann auch der Lernerfolg der Schüler*innen überprüft werden.
Literatur
Lehrerinnenfortbildung Baden-Wüttemberg (o.J.): Gruppenpuzzle, Abrufbar unter: https://lehrerfortbildung-bw.de/st_if/bs/if/unterrichtsgestaltung/methodenblaetter/gruppenpuzzle.html (Letzter Zugriff am 08.02.2024).
Transfer (2021): Fünf Säulen einer guten Unterrichtsvorbereitung. Das AVIVA-Modell im Blended Learning, Abrufbar unter: https://transfer.vet/das-aviva-modell-im-blended-learning/ (Letzter Zugriff am 08.02.2024).
Lizensierung
Das Gruppenpuzzle by Sara Ammoura is licensed under CC BY-NC 4.0