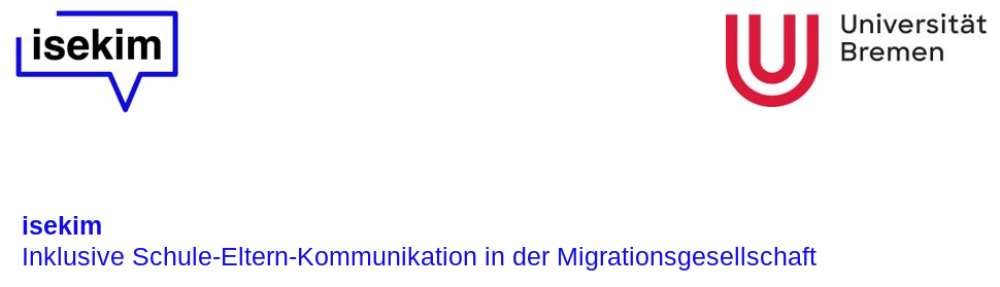In welchen Fällen sollten Schüler*innen in der Schule übersetzen? „Nie!“ lautete die häufigste Antwort in der Diskussion mit Vertreter*innen von isekim-Kooperationsschulen. Oft helfen Vertraute aus Familien bei der Sprachmittlung, oder es wird auf mehrsprachige Lehrkräfte oder professionell oder ehrenamtlich Übersetzende zurückgegriffen (siehe Beispiele im Deutschen Schulportal).
Aber nicht immer, insbesondere, wenn es schnell gehen muss, lässt sich die Mittlungstätigkeit der Kinder für ihre Eltern vermeiden, wie eine Lehrkraft in diesem Interview berichtet: „Wir hatten gestern ein Konfliktgespräch, wo dann Familienangehörige ausgefallen sind, die übersetzen sollten. Und dann wurde uns vorgeschlagen, dass das Kind, also dass der Schüler, um den es in dem Gespräch ging, dass er übersetzen sollte. Es war natürlich ein ganz kurzes Gespräch, weil das für uns ganz wichtig war, dass es eben eine andere Person macht.“
Wenn Lehrkraft, Eltern und Schüler oder Schülerin an einem Tisch sitzen und über die Lernentwicklung und den Leistungsstand reden, müssen Jugendliche mit mehreren Rollen zurechtkommen. Welche pädagogischen Fallstricke das mit sich bringt, wurde in einer Masterarbeit an der Universität Bremen deutlich, für die Schüler*innen interviewt wurden.* In dieser Situation sind sie nicht nur Gesprächsteilnehmende, sondern zugleich auch Gesprächsgegenstand. Wenn sie dann noch übersetzen, kommt eine dritte, verantwortungsvolle Rolle hinzu: die der sachgerechten Informationsübermittler*innen zwischen zwei oder mehr Sprachen. Das kann Selbstwirksamkeitserfahrungen bei Schüler*innen nach sich ziehen, die hier eine Anerkennung ihrer Sprach- und Mittlungskompetenzen erfahren können. Aber es birgt auch Risiken. Wobei die Übermittlung wichtiger Botschaften nicht nur abhängig davon ist, ob die entsprechenden Sprachen beherrscht werden. Vor allem, wenn Jugendliche emotional berührt sind und/oder negative Konsequenzen fürchten, wird die Überforderung mit dieser hochkomplexen Aufgabe offensichtlich. Auch auf das Vertrauensverhältnis zwischen Schule-Eltern-Schüler*innen kann dies negative Auswirkungen haben. Grundlegend erfordert der (begrenzte) Einsatz von Schüler*innen als Mittler*innen in eigener Sache in der Kommunikation zwischen Schule und Eltern hohes Verantwortungsgefühl und Sensibilität bei den Erziehungsverantwortlichen auf beiden Seiten. Das macht der unten stehende Comic deutlich.
Der Comic könnte z.B. in Weiterbildungsworkshops eingesetzt werden, um die Bereitschaft zu kommunikativen Schleifen zur Verständnisüberprüfung anzuregen, z.B. mit folgender Aufgabe: Versetzen Sie sich in die Situation der Lehrkraft oder des Elternteils. An wen würden Sie den nächsten Satz richten? Was würden Sie sagen?
Zum Weiterlesen: Deutsches Schulportal, Dossier: Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern – Herausforderung und Chance, insbesondere zur Zusammenarbeit trotz Sprachbarriere
Von Dita Vogel und Yasemin Karakaşoğlu
*Vielen Dank an Ezgi Gürsoy und Anika Kalinowski!
Als Handout zum Download hier