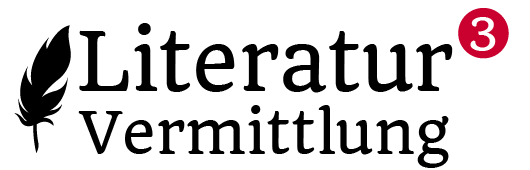Rezension zu Nathacha Appanah: Tropique de la violence. Gallimard 2016
von Sophia Dziwis
Vor der malerischen Kulisse der Kokospalmen und Mangobäumen des französischen
Überseedépartements Mayotte zeichnet Nathacha Appanah in Tropique de la violence das Bild einer zerrissenen und von Konflikten erschütterten Gesellschaft.
Auf der anderen Seite des Äquators, könnte man meinen, läge ein tropisches Paradies: Mayotte ist eine von Palmen und Obstbäumen gesäumte Insel mitten im indischen Ozean. Wer jedoch in die Lektüre von Tropique de la Violence einsteigt, erfährt schnell: Mayotte ist gespalten. Gemieden von der besseren Gesellschaft, die in Steinhäusern wohnt und im wohligen Schatten ihrer Terrassen und Hinterhöfe ein friedliches Familienleben führt, findet in den staubigen Straßen Gazas ein täglicher Kampf um Drogen, Geld und Überleben statt. So entspannt sich in der drückenden Hitze der Tropen ein Konflikt zwischen arm und reich, privilegiert und nicht-privilegiert und letztlich auch zwischen schwarz und weiß.
Appanahs Roman lässt sich als eine Gesellschaftsstudie lesen, die aber doch keine sein will. Man ist nicht Beobachter, der außerhalb des Geschehens steht, sondern stürzt mitten hinein in die Straßen der Hauptstadt von Mamoudzou und die Geschichten ihrer Bewohner.
In der Mitte der verschiedenen Sprecher steht Moise, Sohn einer der vielen anonymen und unsichtbaren geflüchteten Frauen der umliegenden Inseln, die auf ein besseres Leben und die französische Staatsbürgerschaft für ihre Kinder hoffen – adoptiert von einer Französin.
Er steht zwischen den Welten und erscheint als Getriebener der Frage nach seiner Identität und Herkunft: Wer bin ich und wohin gehöre ich? Als seine Adoptivmutter plötzlich stirbt, verliert er jeglichen Halt und begibt sich auf der Suche nach sich selbst in den reißenden Strudel der Gewalt der Straßen Gazas.
Dass der Titel des Romans an den Reisebereicht des Ethnologen Claude Lévi-Strauss Tristes Tropiques erinnert, ist wohl kein Zufall. In seinen Überlegungen zu den indigenen Völkern in Brasilien befürchtet dieser den Niedergang der Kulturen durch den Kontakt mit der „zivilisierten“ Welt. Vor der Annahme einer definierbaren Struktur, die einer jeden Kultur zu Grunde liegt, steht bei ihm – wie auch bei Moise – die Frage nach dem eigentlichen Ursprung im Mittelpunkt.
In dem Roman wird jedoch schnell klar: Es ist eine andere Stufe erreicht. Man ist nicht mehr bestürzter und besorgter Beobachter des Untergangs der Tropen, sondern ist Teil der gewalttätigen Umwälzung, in der sich keine Strukturen mehr ausmachen lassen. Identitäten und Kulturen sind in Bewegung, verschwimmen und erscheinen als komplexe und variable Gebilde, die mit der Zeit, der Geschichte und den Menschen verwoben erscheinen.